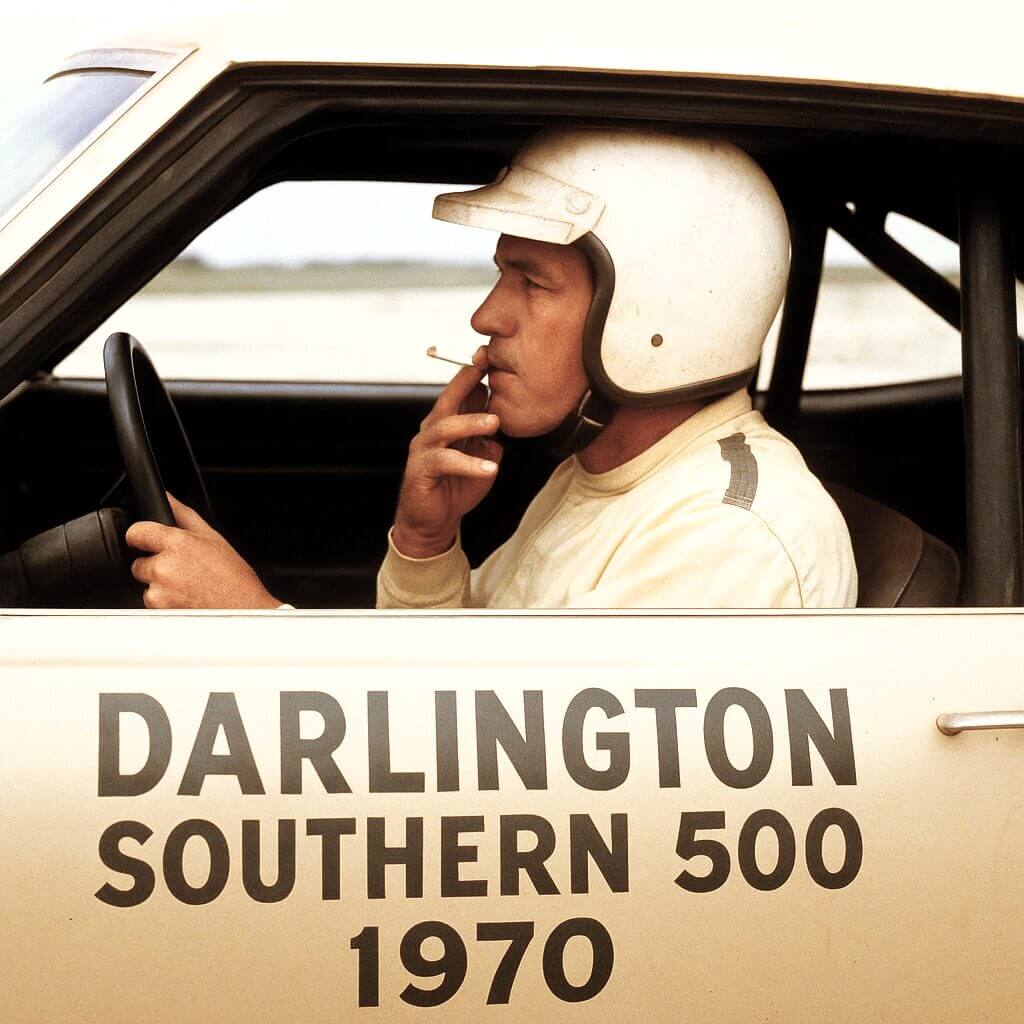McMurtry Spéirling: Gravitationsleugner auf vier Rädern
Der Gedanke, ein Auto könne an der Decke fahren, geistert seit Jahrzehnten durch die Welt des Motorsports. In der Theorie müsste ein Formel-1-Wagen bei ausreichender Geschwindigkeit genug Abtrieb erzeugen, um kopfüber an der Tunneldecke zu haften. Doch bis jetzt war das eine Spielerei für Physiklehrer – keine Praxis.

Das britische Unternehmen McMurtry hat diesen Gedanken nun ernst genommen und in die Realität überführt. Mit einem speziell vorbereiteten Versuchsaufbau hat der vollelektrische McMurtry Spéirling demonstriert, dass seine aktive Aerodynamik ausreicht, um das Fahrzeug auf den Kopf zu stellen – und dort stabil weiterzufahren — wenn auch nur ein paar Zentimeter.
Technik, die hält, was sie verspricht
Der Spéirling arbeitet mit einem radikalen Konzept: Zwei elektrische Lüfter erzeugen konstanten Unterdruck unter dem Fahrzeugboden – unabhängig von der Geschwindigkeit. Dieses Prinzip, bekannt aus dem Chaparral 2J (Ground-effect-Rennwagen) und dem Brabham BT46B, wird hier in konsequenter technischer Weiterentwicklung eingesetzt. Das Resultat: bis zu 2.000 Kilogramm Abtrieb bei jedem Tempo — auch im Stillstand.
Beim Versuch wurde das Fahrzeug auf eine Plattform gefahren, die sich um 180 Grad drehte. Der Spéirling blieb haften – nicht durch Magnete oder mechanische Arretierung, sondern allein durch die Wirkung des Saugsystems. Anschließend fuhr der Wagen unter voller Kontrolle kopfüber weiter.

Was bleibt, wenn man die Show abzieht?
Der Spéirling ist kein Konzeptfahrzeug für die Messehalle, sondern ein fahrbarer Beweis dafür, was technisch bereits heute möglich ist. Das Zusammenspiel aus kompakter Bauweise, aktivem Abtrieb und elektrischer Leistungsentfaltung ist nicht nur für den Rennsport relevant. Auch bei Serienfahrzeugen wie dem Porsche Taycan Turbo oder dem BMW i7 zeigt sich, dass adaptive Aerodynamik zunehmend zum Alltag gehört – sei es durch ausfahrbare Spoiler, variable Luftkanäle oder aktive Kühlluftsteuerung. Der Spéirling treibt dieses Prinzip konsequent auf die Spitze und öffnet den Blick für neue Anwendungen im urbanen und sportlichen Fahrzeugbau.
Was der Rest der Branche daraus machen könnte
Natürlich wird kein Serienfahrzeug künftig kopfüber fahren. Aber der Versuch zeigt, wie weit sich Fahrphysik mit neuen Technologien verschieben lässt. Wo früher Geschwindigkeit Voraussetzung für Anpressdruck war, reicht heute ein elektrischer Impuls. Das eröffnet Spielräume – nicht nur auf der Rennstrecke, sondern perspektivisch auch in der Fahrzeugsicherheit und der Regelbarkeit von Traktion.
Wie sich aktiver Abtrieb sinnvoll übertragen lässt, ist weniger eine Frage der Technik als der Prioritäten. In Hochleistungsfahrzeugen steuern adaptive Systeme heute bereits Luftwiderstand, Kühlluftzufuhr und Stabilität. Im Kompaktsegment fehlt dafür oft der Platz – nicht aber die Relevanz: Gerade leichtere Elektrofahrzeuge könnten von gezieltem Abtrieb bei Seitenwind, Kurvenfahrt oder Vollbremsung profitieren. Entscheidend ist nicht die maximale Kraft, sondern ihre punktgenaue Verfügbarkeit