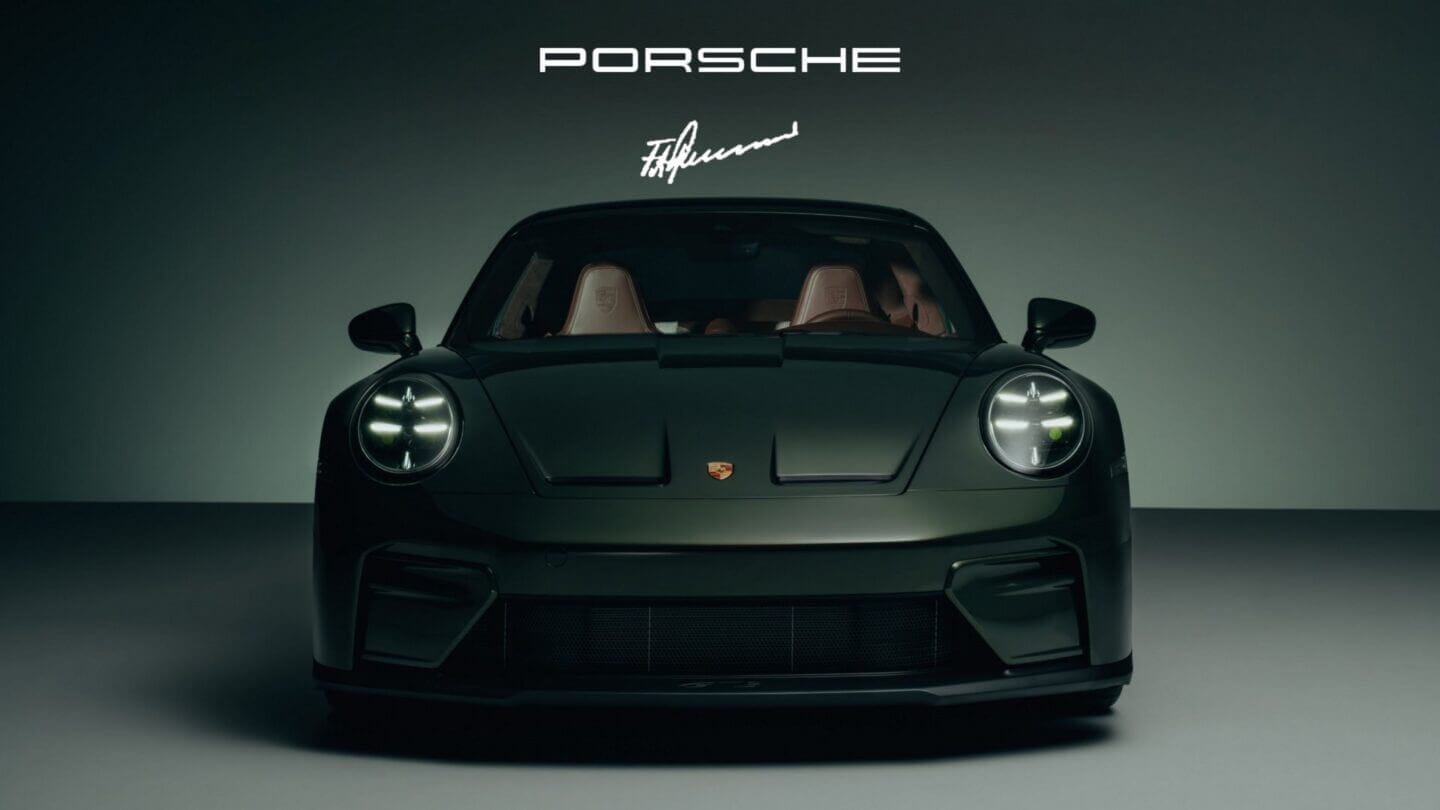Pagani Zonda: Warum es dieses Auto immer noch gibt
Wenn man heute einen Zonda sieht, wirkt er nicht alt – nur unlogisch. Die Welt hat sich längst auf Simulationen, Windkanäle und Plug-in-Leistung geeinigt. Horacio Pagani dagegen baute ein Auto, als würde er eine Kathedrale errichten: aus Carbon, Titan und Besessenheit. Kein anderer Hersteller hat den Sprung von Null zu Mythos so präzise geschafft.
![]()
Der Ursprung liegt in Sant’Agata, bei Lamborghini. Dort arbeitete Pagani in den Achtzigern an Verbundwerkstoffen, entwickelte die ersten Carbonteile für den Countach Evoluzione und stieß an die Grenzen eines Konzerns, der keine Zukunft für Kohlefaser sah. Also gründete er 1991 seine eigene Firma – Modena Design – mit einer Idee: Ein Auto aus einem Material zu bauen, das bis dahin nur in der Luftfahrt selbstverständlich war. 1999 erschien der Zonda C12.

Zonda F 02/Foto: Pagani Automobili
Der Motor war ein Geschenk und ein Statement: der M120, ein 6,0-Liter-V12 aus Affalterbach wurde ursprünglich für die S-Klasse entwickelt. In seiner neuen Umgebung lieferte er 394 PS – nicht beeindruckend nach heutigen Maßstäben. Aber kombiniert man das mit 1.250 Kilo Leergewicht und einem Chassis, das wie ein Stück Architektur wirkte, sieht die Sache anders aus.
Der C12 war noch roh, ein Erstlingswerk mit sichtbaren Nahtstellen. Doch schon der Zonda S (2001) zeigte, was Pagani verstand: Evolution ohne Kompromisse. Mehr Hubraum, 7,0 Liter, 550 PS, ein handgeschaltetes Cima-Sechsgang-Getriebe, aktives Aeropaket. Der Wagen wirkte wie eine Studie, die jemand vergessen hatte, zurück in den Prototypenraum zu rollen. Und er klang wie ein Orgelregister aus Metall.

Zonda C12/Foto: Pagani Automobili
Während Ferrari mit dem Enzo und Porsche mit dem Carrera GT die Zukunft suchten, verfeinerte Pagani sein Werkzeug. Zonda F (2005) war die erste Version, die sich gegen die großen Namen messen ließ. 7,3 Liter, 602 PS, 1.230 Kilo, ein Fahrgefühl, das keine Elektronik filtern musste. Die Presse verglich ihn mit einem modernen F40, nur präziser gebaut. Die Carbonteile wurden im Haus laminiert, das Titan verschraubt, als ginge es um Uhrwerke, nicht um Autos.
Der Cinque (2009) war dann die Destillation dieser Philosophie. Nur fünf Exemplare, erstmals Carbon-Titanium-Fasern im Monocoque. Gewicht: 1.210 Kilo. Leistung: 678 PS. Preis: irrelevant. Kein anderes Auto dieser Zeit zeigte so offen den Konflikt zwischen Ingenieuren und Sammlern. Auf der einen Seite war der Cinque ein Labor für Materialien, auf der anderen eine Art Kunstobjekt mit Straßenzulassung.

Zonda S Roadster/Foto: Pagani Automobili
Technisch war der Zonda da längst überreif. Aber Pagani hörte nicht auf, weil seine Kunden weiterhin bestellten. Sie bestellten Sonderanfertigungen, Re-Editionen, Roadster mit anderem Layout, Gitterrahmen und Einzelmotoren. Es gibt keinen klaren Punkt, an dem die Produktion endete. Der letzte offiziell ausgelieferte Zonda war 2017 der HP Barchetta. Drei Exemplare wurden gebaut. Er hatte ein manuelles Sechsganggetriebe, 789 PS, wog 1.250 Kilo und ein Preisschild jenseits von zehn Millionen.
Was den Zonda einzigartig macht, ist nicht seine Leistung, sondern seine innere Logik. Während andere Marken ihre Autos in Generationen denken, versteht Pagani sie als Kompositionen. Kein Zonda gleicht dem anderen, und doch erkennt man jeden sofort: das Seitenprofil wie ein gespannter Muskel, die vier Endrohre in Kreuzform, die Scheibe wie ein Tropfen. Alles Material, nichts Dekor.

Zonda C12/Foto: Pagani Automobili
Sein V12 war nie aufgeladen, nie hybridisiert. Er stammt aus einer Zeit, in der man Drehmoment noch mit Pedaldruck erzeugte. 7.500 U/min, frei atmend, mechanisch ehrlich. Dieses Triebwerk ist der letzte große Sauger-V12 Europas, bevor Abgasnormen und elektrische Zukunftspläne den Klang erstickten. Dass Pagani den Block bis heute nutzt – leicht verändert im Huayra R – zeigt, wie robust die Basis ist.
Auch in der Fertigung ist der Zonda ein Anachronismus. Keine Fließbänder, kein Roboterpark. Die Carbon-Schichten werden in Handarbeit gelegt, die Schrauben mit Drehmomentschlüsseln aus der Uhrmacherei angezogen. Das erklärt, warum der Zonda 20 Jahre lang existieren konnte, ohne veraltet zu wirken. Außerdem gab es einfach keinen Nachfolger, der ihn wirklich ablöste.

Das Lenkrad wird in Handarbeit hergestellt/Foto: Pagani Automobili
Der Huayra war offiziell der Ersatz. Doch wo der Zonda roh und direkt war, ist der Huayra ein Designerstück – komplizierter, digitaler, weniger greifbar. Selbst Pagani-Kunden bevorzugen den alten, weil er ehrlicher wirkt. Viele lassen ihre Zondas modernisieren, neu laminieren, sogar re-homologieren. Es gibt heute mehr straßenzugelassene Zondas als je zuvor, obwohl die Produktion längst vorbei sein sollte.
Diese Dauerhaftigkeit ist das eigentliche Phänomen: Ein 1990er-Jahre-Auto über zwei Jahrzehnte hinweg relevant zu halten – nicht durch Marketing, sondern durch Substanz. Der Zonda war nie Teil eines Konzernportfolios, nie Ergebnis eines PowerPoint-Prozesses.

Pagani Huayra Epitome/Foto: Pagani Automobili
Der Zonda markiert den Punkt, an dem Handwerk im Automobilbau seinen Höchstwert und gleichzeitig sein Ablaufdatum erreichte. Kein anderer Hersteller hat danach versucht, ein Auto in dieser Tiefe manuell zu fertigen – weil es sich wirtschaftlich nicht mehr abbilden lässt.
Der Zonda wird weiter existieren – nicht, weil er gebaut wird, sondern weil er sich warten lässt. Pagani hat ein System geschaffen, das jede Revision, jede Neu-Laminierung, jede Re-Homologation ermöglicht. Solange es Kunden gibt, die bezahlen, bleibt der Zonda technisch lebendig. Er wird damit zum Sonderfall einer Industrie, die sonst auf Obsoleszenz programmiert ist. Während Hypercars nach wenigen Jahren durch Nachfolger ersetzt werden, wächst der Zonda horizontal: in Varianten, Materialzuständen und Evolutionsstufen.
Fotos: Pagani Automobili